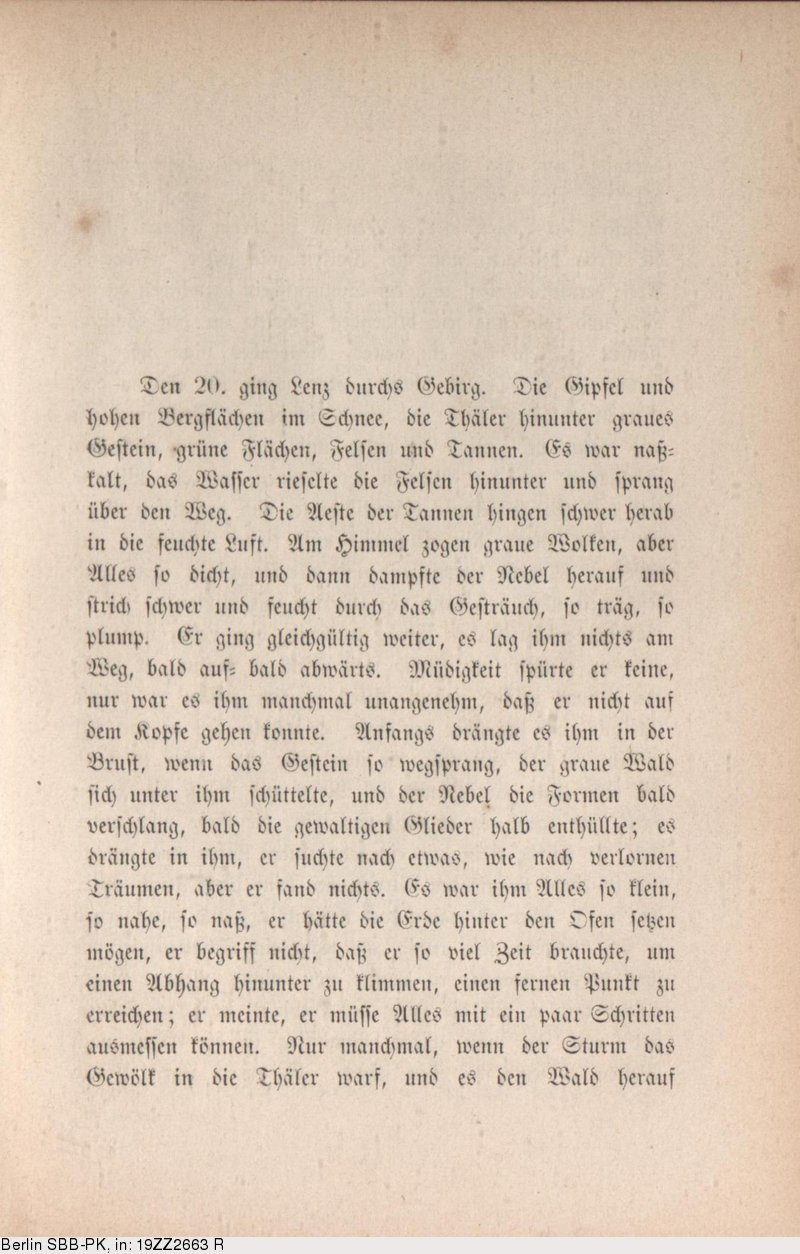Kohärenz und Vorstellungswelt bei Textanfängen
Mein Standort: 1999 meinte ein männlicher Kollege auf einer Tagung über Textlinguistik, die ich in Lyon veranstaltet hatte, Textlinguistik sei eine Sache von Frauen, wahrscheinlich, so zumindest habe ich es verstanden, die moderne Variante von Kirche in den drei berühmten Ks. Nach reiflicher und etwas nachtragender Überlegung möchte ich das etwas abschätzige Urteil umdrehen: Textlinguistik ist eine viel zu ernste Angelegenheit, als dass wir sie den Männern überlassen könnten. Und in der Tat: Frauen haben auf diesem Gebiet bisher Hervorragendes geleistet. Ich bekenne mich also ohne Wenn und Aber zur Textlinguistik.
Mein Vorgehen ist durchaus ein empirisches, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist nicht besonders rühmlich: Ich bin ziemlich unfähig, mit mathematischen Modellen etwas anzufangen. Ein einziges Beispiel: Mehler entwickelt im von Pohl herausgegebenen Band über Prozesse der Bedeutungskonstitution ein Textmodell, das aus lauter Formeln besteht und kein einziges Beispiel enthält. Solange er Sätze schreibt, kann ich ihm noch folgen. Sobald mathematische Formeln überwiegen, muss ich passen.
Der zweite Grund, warum ich auf Empirie angewiesen bin, ist etwas besser: Als Auslandsgermanistin (die oft Übersetzungskurse macht) bin ich mit Problemen konfrontiert, die Muttersprachler nicht kennen. Wenn Studenten einen Text falsch verstehen, muss ich mich fragen, woher das Missverständnis rührt, und andererseits muss ich ihnen die Mittel zur Verfügung stellen, damit sie Texte als kohärente Gebilde aufnehmen. Unter allen Fragestellungen, die in der Textlinguistik geläufig sind, ist vielleicht für mich die erste: Wie versteht man einen Text? Was macht einen Text kohärent und für den Rezipienten verständlich? Es stellt sich vielleicht die Frage, ob eine solche Perspektivierung neue Einsichten in das System einer Sprache vermittelt oder im Gegenteil den Sinn für das Wesentliche versperrt, sie ist jedoch für Sprachlehrer unumgänglich.
Zum Glück haben sich schon viele Linguisten solche Fragen gestellt und einige Antworten geliefert, leider aber keine eindeutigen. Deshalb möchte ich der eigentlichen Textanalyse einen kurzen Überblick über gewisse Konzepte voranstellen, um deutlich zu machen, wie ich sie begreife.
Zur Klärung von einigen Konzepten
Kohäsion und Kohärenz
Als erster Stein des Anstoßes steht natürlich das Paar "Kohäsion und Kohärenz". Der Beitrag von Rickeit & Schade (im Band Textlinguistik der Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 2000) zeigt die Vielfalt der Auffassungen.
Seltsamerweise übersehen die Autoren die gesamte deutsche Literatur zu dem Problem und stützen sich ausschließlich auf amerikanische Arbeiten, wie auch Mehler in dem oben zitierten Beitrag. Die deutschsprachige Literatur zu diesem Thema ist aber umfangreich genug, um die Reflexion zu nähren (Vgl. de Beaugrande/Dressler 1981; Heinemann/Viehweger 1990, Vater 2001, der sich ausführlich mit den Kriterien von Dressler/de Beaugrande auseinandersetzt, Brinker 1997, Sandig 2000 und 2006).
Für mich sind Kohäsion (grammatische Zusammengehörigkeit wie Tempusfolgen, Anaphern, usw.) und Kohärenz (semantische Relationen wie Vorzeitigkeit/Nachzeitigkeit, Agens-Patiens-Rollen usw.) beide Seiten derselben Medaille, selbst wenn oft gezeigt wurde (Vater, Rickeit), dass sie getrennt in einem (kurzen) Text vorhanden sein können: in der Satzfolge Es regnet. Gib mir die Bibel besteht anscheinend keine Kohäsion, doch wussten die Studenten einen Zusammenhang (eine Kohärenz) herzustellen. Beide Phänomene ergänzen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle einander. Ich sehe bisher keinen zwingenden Grund, die Ausführungen von Dressler/de Beaugrande gänzlich zu verwerfen und schreibe jedenfalls beiden Konzepten einen heuristischen Wert zu, ich stimme jedoch Vater zu, wenn er Kohärenz-Beziehungen als "notwendig und hinreichend für das Zustandekommen eines Textes" nennt (Vater, 2001, 54).
Auf welche Definition von Kohärenz können wir uns einigen?
Vater (2001, 38) sagt treffend, "Kohärenz in einem Text baut auf der Sinnkontinuität der zugrundeliegenden Textwelt auf." Und in ihrem Beitrag über "Text als prototypisches Konzept" hat Sandig (2000, 95) Kohärenz als "die referentiellen und semantischen Beziehungen zwischen Text-Elementen, die das Thema konstituieren helfen" definiert. Beide Definitionen möchte ich gerne übernehmen, jedoch ein paar zusätzliche Merkmale hinzufügen.
Erstens: Kohärenz ist ein satzübergreifendes Phänomen und daher besteht auch ein Text aus mindestens zwei Äußerungen. Diese Auffassung hat sich mir aufgezwungen, als ich Texte durch Computerprogramme übersetzen ließ (in der Absicht, die Fehler durch Studenten analysieren zu lassen). Da das Programm keinen Zusammenhang (sprich Kohärenz) zwischen den Sätzen herstellen kann, fallen die meisten Übersetzungen sehr ulkig aus. Aus diesem Grund verstehe ich auch Ein-Wort-Äußerungen oder Ein-Satz-Äußerungen nicht als Texte, obwohl sie durchaus eine Bedeutung aufweisen und eine illokutive Funktion (befehlen, warnen, versprechen) haben können.
Zweitens: Kohärenz kann man auch verstehen als die Gesamtmenge der Inferenzen, die einer Folge von zwei oder mehr Äußerungen gemeinsam sind. Halliday/Hasan (zitiert in Vater 2001, 30) hatten schon 1976 darauf hingewiesen, dass Kohäsionsbeziehungen mit Präsuppositionen zusammenhängen. Inferenzen sind aber weiter aufgefasst als bloße Präsuppositionen. Eigentlich bedürfte auch der Terminus Inferenz einer Klärung, ich begnüge mich hier mit einem Hinweis auf den Aufsatz von Pohl "Inferenzkonzept und Bedeutungskonstitution", auf den ich noch später zurückkomme.
Die thematische Progression
Ein weiteres problematisches Konzept ist dasjenige der thematischen Progression, wie es von der Prager Schule (insbesondere von Danes) entwickelt wurde. Es stellt m.E. ein notwendiges Moment in der Linguistik-Geschichte dar, sollte aber inzwischen durch die kognitiven Arbeiten abgelöst werden.
Zwar versucht Küper (1998) das Thema-Rhema-Konzept zu retten und sogar als Sprachuniversalie zu etablieren. Er orientiert sich vor allem an der anglo-amerikanischen Tradition, die diese Begriffe eher kommunikativ als semantisch versteht: "das Thema ist das, worüber etwas mitgeteilt wird; das Rhema hingegen das, was mitgeteilt wird" (Küper 1998, 220). Küper muss aber eine Schwierigkeit überwinden: Die englische Tradition hat eine Variante eingeführt, die sich nicht ganz mit der ursprünglichen Auffassung deckt. Danach wird das Thema als das Bekannte, Vorerwähnte (given) definiert, während das Rhema die neuen Informationen (new) zusammenfasst. Küper versucht diese Unstimmigkeit zu überbrücken, indem er die erste Auffassung als sprecherbezogen interpretiert und die zweite als hörerbezogen.
Selbst wenn dieser Erklärungsansatz auf den ersten Blick einleuchtend erscheint, möchte ich ihn ablehnen, da beide Aspekte stark interagieren: Der Sprecher konstruiert seine Äußerung, indem er die mögliche Interpretation des Hörers vorwegnimmt. Dabei erwägt er genau, was der Wissensstand des Hörers voraussetzt und wie er die neuen Informationen möglichst kooperativ einbringen kann. Wenn man weiterhin beide Begriffe, die ursprünglich für den Satz erarbeitet wurden, auf den Text anwendet, tauchen neue, gravierende Probleme auf. Schon 1977 haben Gülich und Raible gezeigt, dass die vier Typen der thematischen Progression, wie sie bei Danes erscheinen (einfache lineare Progression, Progression mit durchlaufendem Thema, Progression mit abgeleitetem Thema und Progression mit einem thematischen Sprung), schon in einem einfachen Text schwer zu identifizieren sind. Brinker (1997, 51) beanstandet seinerseits mit Recht den "in sprachtheoretischer Hinsicht unklaren Status des Thema-Begriffs". Trotzdem wurden diese vier Typen unter dem Einfluss von Charolles in die französischen Schulprogramme eingeführt und werden immer noch an elfjährige Kinder vermittelt (siehe: cndp.fr, p. 80).
Die Unschärfe des Thema-Begriffs zeigt sich am ehesten in der IDS-Grammatik (Zifonun et alii), wo Thema und Rhema nicht mehr als gleichrangige Konstituenten des Satzes aufgefasst sind; nur das Themakonzept ist für den Textaufbau relevant, während das Rhema "das lokale, auf die einzelne Äußerung beschränkte Gegenstück" (1997, 511) darstellt. Außerdem hat der Übergang von der Satzebene zu der Textebene zwangsläufig einen neuen Begriff eingeführt, den der Thematisierung, der mir noch problematischer erscheint.
Ein Blick in die Literatur zeigt, dass die Anwendung des Begriffs recht unklar und uneinheitlich bleibt. Für die Grundzüge (728 ff.) meint einerseits Thematisierung die Selektion eines Elements innerhalb des Themabereichs, das dann an die Satzspitze gestellt wird, andererseits aber die Hervorhebung einer besonderen Einheit durch seine Stellung an die Satzspitze, selbst wenn diese Einheit rhematisch ist (756ff.)! Gleichermaßen kann Schwarz (2000, 91) indirekte Anaphern als rhematische Thematisierungen definieren, sie fügt aber in einer vielsagenden Fußnote hinzu:
Es ist in der Forschungsliteratur nicht eindeutig festgelegt, was unter Thema, Rhema, Progression und Kontinuität zu verstehen ist. [...] Meiner Ausführung liegt eine kognitiv und gedächtnisfunktional ausgerichtete Bestimmung von Thema und Rhema zugrunde. Thematische und rhematische Informationselemente in Texten unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Erreichbarkeit im Gedächtnis des Rezipienten. Es handelt sich also um mentale Informationswerte, die sprachlichen Repräsentationen zugesprochen werden. (Schwarz 2000, 92)
Dem ist völlig zuzustimmen. Aber selbst eine strengere Begrenzung der Konzepte würde wahrscheinlich nicht viel weiter helfen. Die meisten Arbeiten befassen sich selten mit Satzfolgen von mehr als zwei bis drei Sätzen, und wenn sie dieses Wagnis unternehmen, dann mit konstruierten Beispielen, die ins Schema passen. Versucht man die Typen von Danes in längeren Texten ausfindig zu machen, merkt man schnell, dass dies aussichtslos ist.
Selbst die oft zitierten Märchenanfänge entsprechen nicht dem Muster, sobald man über die ersten drei bis vier Sätze kommt. Zwar verläuft der Text linear, d.h. man kann ein Vorher und ein Nachher ausmachen, in der mentalen Vorstellung des Rezipienten wird aber diese Linearität verwandelt und netzartig verarbeitet. Alle Arbeiten, die von Thema und Thematisierung sprechen, behandeln in Wirklichkeit ein Kernproblem der Textkonstitution, nämlich die Einführung und Wiederaufnahme von Redegegenständen im Text, und Brinker (1997, 51) muss man Recht geben, wenn er meint:
Die Analyse der Thema-Rhema-Gliederung eines Textes führt kaum über das hinaus, was nicht auch durch eine Beschreibung nach dem Prinzip der Wiederaufnahme erfaßt wird.
Von den vielen Vorbehalten, die man gegenüber diesen Begriffen geltend machen kann, halte ich also zwei fest:
Es gibt meistens in einem Text nicht nur ein Thema, sondern mehrere zugleich.
Diese wohlbekannte Tatsache (ver)leitet die Autoren der IDS-Grammatik (510 f.) dazu, zwischen Haupt- und Nebenthemen, zwischen Ober- und Unterthemen zu differenzieren, von Neuthematisierung, Initialthematisierung, Rethematisierung und Dethematisierung zu sprechen, ohne dass sie aber Mittel zu deren Erkennung liefern.
Die Bezeichnungsphänomene im Text basieren einerseits auf Wiederaufnahmeverfahren, die gut erforscht sind, wie direkte und indirekte Anapher, Synonymie, Hyperonymie, usf., und für welche die Thema-Rhema-Gliederung nur in seltenen Fällen von Nutzen ist. Aber sie setzen andererseits eine ganze Reihe von kognitiven Mechanismen ins Spiel, die mit dieser Theorie überhaupt nicht erfassbar sind.
Das soll nun das Textbeispiel 1 dokumentieren, worauf ich mehrmals zurückkommen werde.
Der Wärter gab ihm seine Sachen, der Kassierer händigte ihm sein Geld aus, der Türsteher schloß vor ihm die große eiserne Tür auf. Er war im Vorgarten, er klinkte die Gartenpforte auf, und er war draußen.
So, und nun sollte die Welt was erleben. (Georg Heym)
Der erste Satz reiht parallel drei Propositionen; sie weisen zwar alle eine gleiche Thema-Rhema-Gliederung auf, und man könnte eventuell von einer Progression mit durchlaufendem Thema sprechen. Jedoch ist mit einer solchen Feststellung wenig über die Kohärenz des Ganzen gesagt. Es wäre zuerst zu rechtfertigen, warum wir das dreimalige Vorkommen von ihm als koreferent interpretieren. Und das Konzept der thematischen Progression kann auch nicht erklären, warum wir spontan alle drei Propositionen und auch die nächsten drei als Darstellung von aufeinander folgenden (d.h. nicht gleichzeitigen) Sachverhalten auffassen. Eine eingehende Analyse müsste aber solche Mechanismen einbeziehen.
Bracic (2003, 29) zeigt seinerseits, dass die Progression auch durch die rhematischen Satzkonstituenten weitgehend bedingt ist. Er bemerkt am Ende seines Aufsatzes, dass "die interphrastische Vernetzung im Text vielschichtig und mehrdimensional ist und über die Thema-Rhema-Gliederung hinausreicht.". Gerade dieser Punkt scheint mir wichtig: Das Danessche Schema der thematischen Progression basiert auf der Linearität des Textes, während die Verstehensprozeduren netzartig verlaufen. Der Rezipient des ersten Textbeispiels muss gleichzeitig mehrere Informationen verarbeiten und miteinander verknüpfen, wobei viele Informationen nicht eindeutig sind: Der definite Artikel Singular weist im Prinzip auf einen in der Textwelt identifizierbaren Referenten hin, der Leser verfügt aber am Anfang über keine Identifizierungshilfen, er kann (wie gesagt) auch nicht sicher sein, dass alle Vorkommen von ihm koreferent sind, und erst die letzte Proposition des zweiten Satzes weist eindeutig nach, dass der Protagonist drinnen war, als die Erzählung beginnt. Alle diese Informationen werden aber parallel verarbeitet, wie die kognitiven Studien zeigen. Das führt mich also zu meinem dritten kontroversen Konzept, das der kognitiven Schemata.
Kognitive Schemata (bzw. skripts, Szenarios)
Kognitive Schemata sind mentale Modelle, die jedes Individuum im Laufe seines Lebens erlernt, und die ihm dazu verhelfen, die Welt zu verstehen und sich darin adäquat zu verhalten (also z.B. Arztbesuch, Essen im Restaurant, Vorstellungsgespräch, usw.). Dieser Forschungszweig bietet ein offenes Modell, das viele Fassungen kennt und oft wegen seiner Unschärfe kritisiert wurde, für welches ich aber gern eine Lanze brechen möchte. Unter den vielen Darstellungen greife ich die von Pohl (2002, 20-21) auf, die knapp das Wesentliche zusammenfasst:
Die Einbettung von kognitiven Schemata in eine Verstehenstheorie basiert auf der Annahme, dass zur Textrezeption benötigtes Wissen in kognitiven Schemata beim Rezipienten gespeichert ist und dass die Semantisierung sprachlicher Ausdrücke die Aktivierung solcher gespeicherten kognitiven Schemata voraussetzt.
Pohl setzt hinzu, dass
der Inferenzbildung im Rahmen holistisch-dynamischer Textrepräsentation die Funktion zugeschrieben wird, ein "passendes" Schema zu aktivieren und die Leerstellen inferentiell zu schließen, entweder mit Elementen aus einem materiellen Text oder mit Elementen aus dem Vorwissen des Rezipienten, die Normalfallregularitäten entsprechen. (2002, 22-23)
Schwarz präsentiert in ihren vielen Arbeiten zur kognitiven Linguistik ein ähnliches Bild. Sie hat sich in ihrer Habilitationsschrift (2000) dieses Modell für die Beschreibung von indirekten Anaphern zunutze gemacht, und dabei die Bedeutung der Schemata für Wiederaufnahmeverfahren eindeutig bewiesen. Sie unterscheidet drei Prozeduren für das (mentale) Erreichen von Textreferenten, die den vielfältigen Referenzketten zugrunde liegen:
Aktivierung: Ein bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erwähnter Textreferent wird eingeführt und erhält einen Knoten (eine kognitive Adresse) im konzeptuellen Netz des Textweltmodells. Der sprachliche Ausdruck steht auf der Ebene des Kurzzeitgedächtnisses im Fokus. Dadurch ist der dazugehörige Referent im Textweltmodell salient. Damit werden thematische Einheiten erfasst.
Re-Aktivierung: Der Knoten wird im Kurzzeitgedächtnis erneut aktiviert. Die Re-Aktivierung entspricht der anaphorischen Wiederaufnahme des Referenzbezugs. Der Textreferent bleibt salient, der Knoten im Fokus.
De-Aktivierung: Durch die Aktivierung eines anderen Informationsknotens verschiebt sich die Aufmerksamkeit auf einen anderen Textreferenten. Der vorher aktivierte Textreferent wird de-aktiviert. Er ist nicht mehr im Fokus, hat aber nun eine kognitive Adresse im Textweltmodell und kann jederzeit erneut aktiviert werden. Im Textweltmodell hat er daher den Status "erreichbar".
Die fünf Typen von indirekten Anaphern, die Schwarz dann auflistet, können m. E. alle auf das Schema-Konzept zurückgeführt werden.
Fazit: Ob man lieber von frames, Schemata, skripts oder Szenarios (Szenen) spricht, scheint mir hier zweitrangig zu sein. Hauptsache bleibt, dass der Rezipient jeden neuen Text/jeden neuen Textteil in ein (bereits) gespeichertes Szenario einfügen muss. Sonst ist kein Verstehen möglich.
Fiktive Textanfänge
Fiktive Textanfänge werden dadurch gekennzeichnet, dass die Vorstellungswelt (oder die Textwelt), die ihnen zugrunde liegt, und die vom Leser rekonstruiert werden soll, noch keinen Bestand hat. Der Titel des Romans oder der Erzählung gibt meistens keine ausreichende Auskunft über die Welt des Textes, zumal viele Autoren ihr Spielchen mit dem Leser treiben und ihn bewusst in die Irre führen. Im Gegensatz zu Wirklichkeitstexten, bei deren Verständnis ein Maximum an Weltwissen mitwirkt, sind fiktive Text-Anfänge relativ "jungfräulich". Hier kann man wahrscheinlich am besten nachvollziehen, wie sich Bedeutung konstituiert und wie sie rekonstruiert wird. Hier könnte und sollte man wahrscheinlich Verstehenstests machen, meine Erfahrungen basieren auf viel zu kleinen Gruppen, um allgemeingültige Aussagen zu rechtfertigen.
Die Literaturwissenschaft hat die typischen Textanfänge klassifiziert, so z.B. del Lungo (2003), der verschiedene Topoi aufzählt (d.h. prototypische Anfänge, wie Abreise des Helden, Ankunft, Entdeckung, Verwandlung, Warten, usw.) und auch eine Typologie erstellt, nach zwei Kriterien: Ob der Anfang dynamisch oder statisch ist und ob der Autor viele bzw. wenige Informationen zur Verfügung stellt.
Wenn seine Typologie für die Charakterisierung eines bestimmten Autors hilfreich sein kann, bringt sie aber wenig für das Verständnis der Kohärenz eines jeweiligen Textes, weil die Interpretation (d.h. die Aufstellung einer eigenen Textwelt) in jedem einzelnen Fall neu einsetzen muss. Es stimmt aber, dass ein erfahrener Leser wahrscheinlich eine Menge von typischen Anfängen (die auch Schemata entsprechen) in seinem Langzeitgedächtnis gespeichert hat und sich deshalb viel leichter in jede neue Erzählung einlesen kann.
Die Arbeit mit fiktiven Erzählungen lohnt sich auch deshalb, weil die Textsorte relativ eindeutig festgelegt ist (und von der Forschung ausreichend untersucht). In dem Pakt, der dem Lesen von Romanen zugrunde liegt, steht die Annahme, bzw. die Erwartung des Lesers, einen kohärenten Text vor Augen zu haben. Er wird also alle ihm gelieferten Hinweise ausnützen, um diese Kohärenz zu rekonstruieren, koste es, was es wolle. Bei Gedichten ist es wahrscheinlich schwieriger, Regularitäten festzustellen.
Insofern muss meine vorige Behauptung über die Jungfräulichkeit eines jeweiligen Textanfangs etwas relativiert werden. Der Leser ist mindestens über den fiktionalen Pakt informiert und besitzt eine mehr oder weniger ausgeprägte Kenntnis der prototypischen Textanfänge. Das reicht aber nicht aus, um ein reibungsloses Verstehen zu garantieren.
Der erste Satz eines Textes zwingt den Leser zu einem Maximum an kognitiver Arbeit. Das weiß er aber im voraus und ist dazu bereit. Aus allen Inferenzen des Satzes soll er sich ein Szenario zusammenreimen, das mögliche, d.h. kohärente Folgen erlaubt. Ich bemühe wieder mein erstes Beispiel, das mir besonders am Herzen liegt, weil die Studenten dabei eine Fülle an phantasievollen Vorstellungen an den Tag legten. Die erste Proposition bleibt sehr ungewiss, da die Bezeichnung der Wärter mehrere Interpretationen offen lässt (Bahnwärter, Krankenwärter, Leuchtturmwärter sind nur einige vom Wörterbuch nahe gelegte Hinweise). Das Personalpronomen ihm weist nur auf eine männliche Person hin und das Objekt seine Sachen kann sich auch auf vieles (Dokumente, Kleidung, Einkäufe) beziehen. Das Fehlen von zurück in der ersten Proposition lässt auch offen, ob die Sachen dem Wärter oder dem unbekannten Ihm gehören. Man könnte es so interpretieren, als würde ein Wärter einer bestimmten Person z.B. seine Uniform leihen, damit er sich verstecken kann. Das einzige Schema (oder Skript), das zur Verfügung steht, ist also ein sehr allgemeines, etwa: INTERAKTION IM RAHMEN EINER ÖFFENTLICHEN INSTITUTION. Die zweite Proposition engt nur wenig das Spektrum der möglichen Szenarios: Die Einbeziehung von Geld ist ja im Schema der öffentlichen Institution mitgegeben. Die dritte Proposition bringt ein weiteres Element ins Spiel: es handelt sich um eine GESCHLOSSENE INSTITUTION (Bank, Gefängnis, Internat, Krankenhaus, so lauteten einige plausible Hypothesen meiner Studenten). Hier merkt man, wie die lexikalische Arbeit für die Auslandsgermanisten von Bedeutung ist. Von den Annahmen, die die Studenten vorgeschlagen haben, passen die ersten zwei weniger gut zur Bezeichnung Wärter (In der Bank oder im Gefängnis hat man es eher mit Wächtern zu tun, für viele Studenten schien aber der Unterschied irrelevant). Das Adjektiv eisern stützt aber die Interpretation 'GEFÄNGNIS'.
Erst nachdem man den zweiten Satz gelesen hat, werden die anfänglichen Hypothesen bestätigt: Die mit er bezeichnete Person war eingeschlossen, wird nun befreit, was wiederum das Schema 'GEFÄNGNIS' in den Vordergrund treten lässt. Man tippt also auf das Szenario 'HAFTENTLASSUNG'.
Der dritte Satz, der erlebte Rede wiedergibt, klingt wie eine Drohung (wie verstehen wir das aber?) und scheint das eben genannte Schema zu bestätigen. Ich habe aber mit meinen Studenten gemogelt, indem ich den Titel der Erzählung gekappt habe. Der hätte die Interpretationsarbeit ziemlich erleichtert, war aber nicht notwendig, da man das Szenario ohnehin erkennen konnte. Diese grausige Erzählung heißt: Der Irre und erzählt dann die blutige Rache des Freigelassenen. Das Schema des Anfangs lautet also ENTLASSUNG EINES PATIENTEN AUS DER ANSTALT. Erst nachdem dieses Szenario deutlich erkannt wird, kann der Leser die Elemente des Puzzles richtig zusammenfügen und jedem Aktanten die eigene Rolle zuweisen. Für das Verstehen eines Textes in einer Fremdsprache (aber auch in der Muttersprache) sind die ersten Sätze und das Erkennen des richtigen Szenarios entscheidend. Die meisten Übersetzungsfehler sind auf eine Fehleinschätzung des Szenarios zurückzuführen.
Ein zweites Textbeispiel kann das Erstellen von Hypothesen vielleicht noch besser veranschaulichen. Es handelt sich um den Anfang des Romans Die Klangprobe von Lenz. Da der Titel relativ mehrdeutig ist (solange man den Roman nicht gelesen hat), hilft er also wenig zum Verständnis des ersten Satzes. Ich habe diesen Text Studien-Anfängern vorgelegt und war mir dessen völlig bewusst, dass er für sie viel zu schwierig war. Bevor sie den Text bis zu Ende lesen durften, habe ich Ihnen nur den ersten Satz gegeben und sie gebeten, daraus ein kohärentes Szenario aufzubauen: Was/wie/wo/wann/wer erzählt, usw... und Hypothesen aufzustellen, wie der Text weitergehen würde.
Über Nacht hatten sie wieder mal sein Meisterwerk versaut, die - wie ich glaube - gelungenste Figur, die er jemals gemacht hatte, den Wächter. Ich sah es schon von der Bushaltestelle aus, erkannte es an den Leuten, die sich vor dem mittleren Rosenbeet, das mit kalkweißen Steinen umlegt war, versammelt hatten und zu der überlebensgroßen Figur hinaufglotzten, grinsend und amüsiert und bestens unterhalten. Sie stießen sich an, sie hatten sich Erheiterndes zu zeigen - alte Kerle zumeist und kurzhalsige Frauen mit Plastiktüten und vollgestopften Einkaufstaschen -, und hier und da steckten sie die Köpfe zusammen und flüsterten etwas, das ihre gute Laune wach hielt...
Das vermutliche Szenario wurde in mehreren Schritten diskutiert und verfeinert, bis man zum Schema [DENKMALSSCHÄNDUNG] kam. Dann durften die Studenten weiter lesen und sie merkten, dass praktisch alle lexikalischen Lücken (die sie hatten) sich von allein schlossen. Es ging dann gut bis zum Erscheinen eines zweiten Szenarios, das das erste vorläufig in den Hintergrund rücken ließ: das des STAATSBESUCHS.
Wie immer, wenn es darauf ankommt, standen die Ampeln auf rot, und zu allem Überfluß kam auch noch die Kolonne mit dem Staatsbesuch vorbei: weiße Mäuse auf Motorrädern vorneweg und dahinter der kugelsichere Mercedes, in dem das vernarbte Ananasgesicht saß. Nach dem letzten Wagen, in dem die Leute vom Staatsschutz fuhren, kam ich endlich hinüber, doch ich konnte nicht gleich erkennen, was sie diesmal mit dem "Wächter" angestellt hatten, der, aus dichtem kristallinem Kalkstein genommen, im mittleren der drei Rosenbeete stand. (Siegfried Lenz, Die Klangprobe, Hervorhebung von mir, mhp)
Wiederum wurden Hypothesen aufgestellt, die allerdings diesmal mehr mit Weltwissen genährt wurden. Und wieder wurden die lexikalischen Lücken (kugelsicher, weiße Mäuse) durch Rückgriff auf das Szenario geschlossen.
Selbstverständlich sind nicht alle ersten Sätze so aufschlussreich und kristallklar wie im folgenden Beispiel:
Den 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirg. Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee, die Täler hinunter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen.
Es war naßkalt; das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den Weg. Die Äste der Tannen hingen schwer herab in die feuchte Luft. Am Himmel zogen graue Wolken, aber alles so dicht - und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht durch das Gesträuch, so träg, so plump.
Er ging gleichgültig weiter, es lag ihm nichts am Weg, bald auf-, bald abwärts. Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, daß er nicht auf dem Kopf gehn konnte.
Anfangs drängte es ihm in der Brust, wenn das Gestein so wegsprang, der graue Wald sich unter ihm schüttelte und der Nebel die Formen bald verschlang bald die gewaltigen Glieder halb enthüllte; es drängte in ihm, er suchte nach etwas, wie nach verlornen Träumen, aber er fand nichts. Es war ihm alles so klein, so nahe, so naß; er hätte die Erde hinter den Ofen setzen mögen. Er begriff nicht, daß er so viel Zeit brauchte, um einen Abhang hinunterzuklimmen, einen fernen Punkt zu erreichen; er meinte, er müsse alles mit ein paar Schritten ausmessen können.
(Georg Büchner, Lenz)
Hier bietet sich sofort das Szenario BERGWANDERUNG IM WINTER, worin sich alle späteren Bilder ohne weiteres einfügen können. Es kann aber auch passieren, dass erste Sätze zwar bekannte Szenarios in Erinnerung rufen (z.B. WOHNUNGSSUCHE), dass diesem Szenario aber für eine Erzählung keine besondere Relevanz zuerkannt wird.
Gehen und Suchen: unter diesem und jenem Aspekt: eine Wohnung. Man muß zeitlich zurück, auf Modernität verzichten, denn das Moderne ist ausweglos, auch in der Wohnweise, die eher ein ausgeliefertes Hausen ist. Im Neubau herrscht Undurchdringlichkeit. Es gilt einige Opfer: Zentralheizung, fließend Warmwasser, Aufzug, Müllschlucker, Einbauküche, Gewinn: größerer Raum, und, worauf man sich versteift, was man sich in den Kopf gesetzt: der zweite Ausgang. (Günter Kunert, Der zweite Ausgang)
Hier geraten zwei Schemata in Konflikt miteinander. Das Weltwissen-Schema WOHNUNGSSUCHE und das Wissen über Romananfänge. Zumal hier der Erzählpakt ganz offensichtlich missachtet wird: Die Infinitive, die hier sinnlosen Determinantien lassen zwar ein Szenario erkennen, das sich aber nicht in eine konkrete Handlung überführen lässt.
Der zweite Satz bekommt, wie wir schon gesehen haben, auch eine grundsätzliche Funktion. Er kann einfach das eingangs angenommene Schema bestätigen (siehe das Beispiel von Lenz), oder auch den Leser zur Revision seiner Annahmen zwingen. Das kann wiederum auf verschiedene Weise geschehen: entweder engt der zweite Satz den Kreis der Hypothesen ein und bietet eine Unterkategorie des anfänglichen Schemas ein. Diese Taktik ist sehr verbreitet und eigentlich für den Leser noch recht entgegenkommend. Ich habe in Pérennec 2003 den Anfang von Der Richter und sein Henker von Dürrenmatt ausführlich analysiert und gehe deswegen hier nicht darauf ein. Der zweite (oder dritte) Satz kann aber dem Leser nahe legen, dass er sich ein völlig falsches Bild der Situation gemacht hat und die ganze Interpretationsarbeit von neuem anfangen muss. Hier spielt der Autor bzw. der Erzähler mit den Erwartungen des Lesers und dieses Spiel ist für einen Nicht-Muttersprachler viel verwirrender als für einen Muttersprachler. Das heißt, in einem solchen Fall potenzieren sich die kognitiven Forderungen an den Rezipienten. Betrachten wir nun einen weiteren Textanfang, den der berühmten Erzählung Das dreißigste Jahr von Bachmann.
Wenn einer in sein dreißigstes Jahr geht, wird man nicht aufhören, ihn jung zu nennen. Er selber aber, obgleich er keine Veränderung an sich entdecken kann, wird unsicher; ihm ist, als stünde es ihm nicht mehr zu, sich für jung auszugeben. Und eines Morgens wacht er auf, an einem Tag, den er vergessen wird, und liegt plötzlich da, ohne sich erheben zu können, getroffen von harten Lichtstrahlen und entblößt jeder Waffe und jeden Muts für den neuen Tag. Wenn er die Augen schließt, um sich zu schützen, sinkt er zurück und treibt ab in eine Ohnmacht, mitsamt jedem gelebten Augenblick. Er sinkt und sinkt, und der Schrei wird nicht laut... (Ingeborg Bachmann, Das dreißigste Jahr)
Obwohl es keine besonderen lexikalischen Schwierigkeiten bereitet, wird es von französischen Studenten immer als befremdend empfunden. Ich habe versucht, deren Unbehagen zu ergründen und habe Folgendes festgestellt: Die ersten zwei Sätze enthalten allgemeine Bemerkungen über den im Titel angegebenen Sachverhalt: das dreißigste Jahr. Soweit ist noch alles einigermaßen in Ordnung, obwohl damit sich kein eindeutiges Schema abrufen lässt. Es gehört aber zum allgemeinen Wissen über fiktive Texte, dass Autoren ihre Erzählungen gerne mit Plattitüden eröffnen. Dann aber vollzieht Bachmann eine merkwürdige Wendung. Sie nutzt sehr kunstvoll die Zweideutigkeit des Pronomens er aus. Im ersten Satz weist das Indefinitpronomen einer ganz allgemein auf jede männliche (oder vielleicht auch weibliche) Person hin, die dreißig wird. (Davon zeugen unter anderem die Konjunktion wenn und das gnomische Präsens). Da kein anderer Referent vorhanden ist, ist der Rezipient gezwungen, die Pronomina ihn und er im zweiten Satz auf dieses unpersönliche Wesen zu beziehen. Im dritten Satz aber bekommt der Leser den Eindruck, dass dieser er plötzlich ein besonderes Individuum bezeichnet - ein Eindruck, der durch die Kenntnis um das prototypische Erzähl-Szenario 'ERWACHEN DES HELDEN' gerechtfertigt zu sein scheint. Jedoch lässt sich die Zweideutigkeit nicht ganz aus der Welt schaffen, da das Tempus Präsens beibehalten wird, und die Konjunktion wenn wieder auftaucht. Obwohl der Text oberflächlich vollkommen kohäsiv wirkt, lässt sich die Kohärenz nicht wirklich ausmachen, weil die Inferenzen, die der Leser zu rekonstruieren versucht, eben nicht alle miteinander kompatibel sind. Je mehr Prädikationen auf diesen er zutreffen, desto mehr müsste er an Individualität gewinnen. Aber genau das Gegenteil geschieht, und der letzte Satz des Abschnitts wiederholt nur den zweiten: er wird unsicher / um zu sehen, wer er war und wer er geworden ist. Selbstverständlich wurde das Unbehagen des Lesers von der Autorin programmiert und wird nicht nur durch die schwankende Referenz des Pronomens er bedingt. Dieses Beispiel finde ich besonders aufschlussreich, weil es nahe legt, wie die interpretierende Arbeit des Lesers sich über Szenarios und Inferenzen vollzieht.
Mein letztes Beispiel ist ziemlich schwierig, da er bewusst und offen gegen alle Regeln der Textualität verstößt, schon deshalb weil er auf den anfänglichen Großbuchstaben verzichtet:
da dachte ich schlicht und streng anzufangen so: sie rief ihn an, innezuhalten mit einem Satzzeichen, und dann wie selbstverständlich hinzuzufügen: über die Grenze, damit du überrascht wirst und glaubst zu verstehen. Kleinmütig (nicht gern zeige ich Unsicherheit schon anfangs) kann ich nicht anders als ergänzen, daß es im Deutschland der fünfziger Jahre eine Staatsgrenze gab, du siehst, wie unbequem dieser zweite Satz steht neben dem ersten. Dennoch würde ich am liebsten beschreiben, daß die Grenze lang ist und drei Meilen vor der Küste anfängt mit springenden Schnellbooten, junge Männer halten sie in den Ferngläsern,... (Uwe Johnson, Das dritte Buch über Achim)
Der Erzähler gibt hier zu, dass er den Leser irreführen will und selbst deutschsprachige Studenten hatten Bedenken, was hier zu verstehen war. Der erste Satz bietet eine Fülle von Deiktika und Pronomen, deren Referenz im Unklaren bleibt: da, ich, sie, ihn, du. Es dauert aber eine Weile, bis sich der Leser ein kohärentes Bild machen und erkennen kann, dass der Ich-Erzähler (eigentlich eine vertraute Figur) den Leser mit du anspricht und das Erzählte kommentiert, oder vielmehr den Erzählprozess direkt vor den Augen des Lesers entrollt. Das Anfangs-Szenario, das eigentlich eher trivial ist 'ANRUF ÜBER DIE GRENZE' versteckt sich hinter einem zweiten Szenario 'ROMANSCHREIBEN'.
Inzwischen ist ein solches Versteckspiel auch Routine geworden und sollte den meisten Studenten der Germanistik vertraut sein (vgl. Kindheitsmuster von Christa Wolf). Hier jedoch treibt es Johnson ziemlich weit und selbst realistische Hinweise (im Deutschland der fünfziger Jahre) vermögen es nicht immer, ein annehmbares Szenario abzurufen, weil die aneinander gereihten Propositionen ein ziemlich verwirrtes Bild hergeben.
Schlussbemerkung
Ich habe versucht zu zeigen, dass die Beschäftigung mit Texten in einer Fremdsprache, weil sie nicht so selbstverständlich ist wie für Muttersprachler, dem Linguisten andere Anhaltspunkte vermittelt, die sich für die Erfassung der Verstehensprozeduren nützlich erweisen können. Eigentlich verfährt auch Inge Pohl so, wenn sie Pseudo-Wörter in Gedichten von Morgenstern von ihren Studenten analysieren lässt. Es sind auch Fremdwörter in der eigenen Sprache und die Prozeduren zu ihrem Verstehen sind die gleichen wie für Ausländer.
Wenn die Wiederaufnahmeverfahren einen guten Teil der Kohärenz eines Textes ausmachen, darf man deswegen andere Mechanismen nicht unterschätzen: Das Erkennen von Schemata bzw. Szenarios spielt beim Verstehen eine große Rolle, da die verschiedenen Aktanten und Sachverhalte sich zu einem bekannten Ganzen zusammenfügen (so z.B. das Szenario ENTDECKUNG EINER LEICHE im Text von Dürrenmatt, das typisch für jeden Kriminalroman ist).
Dabei sollen bei fiktiven Texten auch die Szenarios, die die Kommunikationssituation bestimmen (den Lesepakt), mit analysiert werden. Dass sich bei jedem Romananfang zwei Szenarios überlagern, erklärt, warum wir manchmal Schwierigkeiten haben, uns in den Text einzulesen. Da würde sich eine echte Kooperation zwischen Linguisten und Literaturwissenschaftlern lohnen, damit eine Typologie der Textanfänge erstellt wird, die beide Komponenten berücksichtigt und ihre Kombinationen genau registriert.
Nun bleiben noch viele Probleme der Textinterpretation zu behandeln, hier litaneiartig aufgelistet:
- Kann man vielleicht das, was ich Szenario genannt habe, mit dem, was Sandig (2000 und 2006) Textthema nennt, gleichsetzen? Es scheint mir einige Unterschiede zu geben, insofern das Szenario ursprünglich da ist, während das Textthema aus dem Text hervorgeht.
- Wie lässt sich die Vielfalt der Szenarios (Themen) in einem Text organisieren? Und wie ist ihre gemeinsame Kohärenz zu analysieren?
- Gibt es gute und schlechte Textanfänge? Und kann man eine Typologie nach linguistischen Kriterien aufstellen?
- Gibt es typisch ostdeutsche Textanfänge? (Kunert, Bobrowski, Johnson, Wolf). Meine Beispiele haben gezeigt, dass die meisten anfänglichen Schwierigkeiten bei den ostdeutschen Schriftstellern anzutreffen sind, und dass diese häufig dem Leser Fallen stellen. Eine (zu) einfache Antwort wäre zu behaupten, dass sie damit die Zensur umgehen wollten.
- Spielt das Wissen über Erzählerfiguren eine Rolle in der Interpretation eines Romananfangs?
- Gibt es spezifische Kohärenzbedingungen für fiktive Texte? Gebrauchstexte wie Kochrezepte oder Wetterbericht z.B. haben spezifische Merkmale. Es liegt auf der Hand, dass in einem Kochrezept alle beschriebenen Handlungen der Reihe nach ausgeführt werden sollen, dass die Reihenfolge der Propositionen also relevant ist. Um diese letzte Frage zu beantworten, würde sich ein eingehender Vergleich von Textanfängen in fiktiven und nicht-fiktiven Texten lohnen.
Bibliographische Hinweise
Adam Jean-Michel, Éléments de linguistique textuelle, Bruxelles, Mardaga, 1990.
Bracic Stojan, "Zur Motivierung der stilistischen Variation von thematischen Satzkomponenten im Text. Gibt es im Text (auch) eine rhematische Progression?", in: Barz I. / Lerchner G. / Schröder M. (Hrsg.) Sprachstil - Zugänge und Anwendungen. Ulla Fix zum 60. Geburtstag. Heidelberg, Winter, 2003, 23-30.
Brinker Klaus, Linguistische Textanalyse, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 1997.
Brinker Klaus/Hagemann Jörg, "Themastruktur und Themenentfaltung in Gesprächen, in: Text- und Gesprächslinguistik, HSK Band 16/2, Berlin/New York, De Gruyter, 2001, 1252-1263.
Danes Frantisek, "Zur linguistischen Analyse der Textstruktur". In: Folia linguistica, Tomus IV, 1970, 72-78.
Del Lungo Andrea, L'incipit romanesque, Paris, Seuil, 2003. Eco Umberto, Lector in Fabula. Die Mitarbeit der Interpretation in erzählenden Texten. München, Carl Hanser Verlag, 1987.
Firbas Jan, "On defining the theme in functional sentence analysis". In: Travaux linguistiques de Prague 2, Prague, Academia, 1966, 267-280.
Grice H. Paul, "Logique et conversation", Communication n° 30, 1978.
Grobet Anne, L'identification des topiques dans les dialogues, Bruxelles, Duculot, 2002.
Gülich Elisabeth/Raible Wolfgang, Linguistische Textanalyse, München, Fink, 1977.
Heidolph Karl Erich/Flämig Walter/ Motsch Wolfgang et al., Grundzüge einer deutschen Grammatik, 2. unveränderte Auflage, Berlin, Akademie-Verlag, 1984.
Heinemann Wolfgang /Viehweger Dieter, Einführung in die Textlinguistik, Tübingen, Niemeyer, 1991.
Kleiber Georges, L'anaphore associative, Paris, P.U.F, 2001.
Küper Christoph, "Thema und Rhema als ein zentrales linguistisches Konzept. Am Beispiel des Deutschen und Englischen". In: Particulae particularum. Festschrift zum 60. Geburtstag von Harald Weydt, Tübingen, Stauffenburg, 1998, 219-231.
Mehler Alexander, "Textbedeutungsrekonstruktion. Grundzüge einer Architektur zur Modellierung der Bedeutungen von Texten". In: I. Pohl (Hrsg.), Prozesse der Bedeutungskonstruktion, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2002, 445-486.
Pérennec Marie-Hélène, "Von der notwendigen Unterscheidung von Fiktion und Nicht-Fiktion bei einer Texttypologie". In: Fix Ulla et alii (Hrsg.), Brauchen wir einen neuen Textbegriff?, Frankfurt am Main/Berlin, Peter Lang, 2002, 97-107.
Pérennec Marie-Hélène, "Inwiefern ist die Unterscheidung 'Thema-Rhema' für den Text relevant?". In: I. Behr & D. Baudot (Hrsg.), Funktion und Bedeutung. Festschrift für F. Schanen, Tübingen, Stauffenburg, 2003, 259-270.
Pohl Inge (Hrsg.), Prozesse der Bedeutungskonstruktion. Sprache - System und Tätigkeit, Band 40, Frankfurt/Main, Peter Lang, 2002.
Rickeit Gert/Schade Ulrich, "Kohärenz und Kohäsion", in HSK 16.1, Text- und Gesprächslinguistik, Berlin, New-York, de Gruyter, 2000, 275-283.
Sandig, Barbara, "Text als prototypisches Konzept", in: Mangasser-Wahl Martina (Hrsg.), Prototypentheorie in der Linguistik, Tübingen, Stauffenburg, 2000, 93-112.
Sandig Barbara, Textstilistik des Deutschen, Berlin/New York, de Gruyter, 2006.
Schwarz Monika, Indirekte Anaphern, Linguistische Arbeiten, Tübingen, Niemeyer, 2000.
Vater Heinz, Einführung in die Textlinguistik, München, Fink, 2001.
Weinrich Harald, Textgrammatik der deutschen Sprache, Mannheim, Duden, 1993.
Zemb Jean-Marie, Konstrastive Grammatik Französisch-Deutsch, Band 1. Mannheim, Duden, 1978.
Zifonun Gisela et alii, Grammatik des Deutschen, Berlin/New York, de Gruyter, 1997.
Quellennachweis
Ingeborg Bachmann, "Das dreißigste Jahr", in: Gedichte und Erzählungen, Zürich, Büchergilde Gutenberg, p. 132.
Georg Büchner, "Lenz", in: Sämtliche Werke und Briefe - Historisch-kritische Ausgabe mit Kommentar, Hrsg. v. Werner R. Lehmann, 3. Auflage, München, Hanser, 1979.
Georg Heym, "Der Irre", in: Deutschland erzählt. Band 4: Von Rainer Maria Rilke bis Peter Handke, Hrsg. v. Benno von Wiese, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1992, p. 32-45.
Uwe Johnson, Das dritte Buch über Achim, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1969, p. 5.
Günter Kunert, "Der zweite Ausgang", in: Deutschland erzählt. Band 4: Von Rainer Maria Rilke bis Peter Handke, Hrsg. v. Benno von Wiese, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1994, p. 232-237.
Siegfried Lenz, Die Klangprobe, München, DTV, 1993, p. 5.
Pour citer cette ressource :
Marie-Hélène Pérennec, Kohärenz und Vorstellungswelt bei Textanfängen, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), mars 2010. Consulté le 03/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/allemand/langue/linguistique-textuelle/koharenz-und-vorstellungswelt-bei-textanfangen



 Activer le mode zen
Activer le mode zen