Die Schreie der Dohle. Einige Anmerkungen zu den Tieren in Kafkas Erzählungen
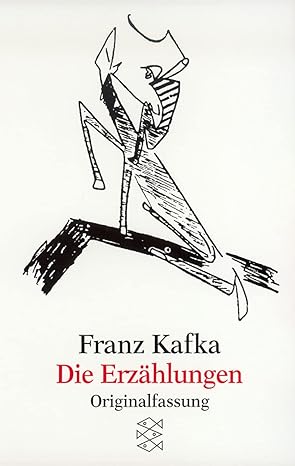
Die Flucht durch den Menschen hindurch ins Nichtmenschliche -- das ist Kafkas epische Bahn.
Theodor W. Adorno
I.
Das Interesse an „Kafkas Tieren“ ((Der vorliegende Aufsatz fasst einige grundlegende Thesen meiner Dissertation aus dem Jahre 2010 zusammen. Jochen Thermann: Kafkas Tiere. Fährten, Bahnen und Wege der Sprache, 2010.)) hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Das hat insbesondere mit einer Forschungsentwicklung zu tun, die über Kafka und die Germanistik weit hinausgeht. Die Veröffentlichungen von Giorgio Agambens Das Offene (2003) und Jacques Derridas L’animal que donc je suis (2006) haben den Geisteswissenschaften einen Impuls verliehen, durch den sich das Forschungsinteresse von tierphilosophischen Fragestellungen auf tierethische und kulturwissenschaftliche Perspektiven erweitert hat. In ihrer Folge bildete sich das neue, interdisziplinäre Feld der animal studies oder critical animal studies heraus. Eine solche Entwicklung wird trotz seiner marginalen Position an den Rändern der Disziplinen bereits als animal turn ((Ritvo, 2007, 118-122.)) der Geistes- und Sozialwissenschaften hervorgehoben. Oft in Analogie zu postkolonialen Diskursen verfolgen die Argumentationslinien ein Denken, das die Herrschaftsstrukturen zwischen Menschen und Tieren kritisch in den Blick nimmt und an die Stelle der Objektivierung des Tiers Fragen nach dessen Subjektivität und Empfinden stellt. Dabei wird auch die anthropologische Schwelle zwischen Tier und Mensch zumindest theoretisch überschritten und beseitigt.
In diesem Sinne scheinen auch Kafkas Tiere an die animal studies anschlussfähig, da sich die Erzählungen tatsächlich auf eine Subjektivität der Tiere zubewegen. In „Ein Bericht für eine Akademie“, gibt ein Affe namens Rotpeter über seine Sprachentwicklung Aufschluss und darüber wie er die „Durchschnittsbildung eines Europäers“ erlangt habe. In „Der Bau“ denkt ein nicht näher definiertes, in der Erde grabendes Tier über seine Bautätigkeiten nach. Kafkas berühmteste Erzählung „Die Verwandlung“ erzählt von den Schwierigkeiten des Familienlebens, nachdem sich die zentrale Figur, der Handlungsreisende Gregor Samsa, in ein Insekt verwandelt hat. Tiere stehen nicht nur im Mittelpunkt des Erzählinteresses, sondern die Erzählungen werden sogar über Tiere fokalisiert. Eine solche interne Fokalisierung stellt nicht nur literarisch eine Neuerung dar, sie wirft durch diesen erzähltechnischen Kniff auch subjekttheoretische und tierphilosophische Fragen auf, die die gängige Differenz von Mensch und Tier ironisieren und hintertreiben.
Das Sujet der literarischen Tierdarstellungen überspannt Kafkas gesamtes erzählerisches Werk von den Anfängen bis zum Spätwerk. Die bereits genannte Erzählung, „Der Bau“ war Kafkas vorletzte Erzählung, und auch in seinem letzten Werk, „Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse“ erzählt eine Maus auf allegorische Weise von der Sängerin Josefine, die ebenfalls eine Maus ist und eine Art Pfeifen als Kunstform praktiziert. Auch für sein Frühwerk lässt sich das Interesse Kafkas an Tieren nachweisen. Der Band Erzählungen, herausgegeben von Roger Hermes, ist chronologisch geordnet und stellt die Miniatur „Wunsch, Indianer zu werden“ aus den „Betrachtungen“ an den Anfang der Ausgabe. Wir können diesen Text durchaus programmatisch lesen, und auch wenn der Titel einen Indianer in den Mittelpunkt stellt, so wird unsere Interpretation hoffentlich Aufschluss darüber geben, warum wir den Bogen der Tierprotagonisten tatsächlich von diesem Text aus spannen können. Wir wollen ihn hier genauer unter die Lupe nehmen, da er erstens sehr kurz ist und sich zweitens tatsächlich einiges Grundlegendes an diesem Text ablesen lässt.
II.
Wunsch, Indianer zu werden
Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden Pferde, immer wieder kurz erzitterte über zitterndem Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf. ((Kafka, 1996, 7.))
Der Text, der aus nur einem einzigen Satz besteht, gehört kulturhistorisch zu den vielen Zeugnissen der deutschen Indianerobsession – ein eigentümliches Phänomen. Dass der Bestsellerautor Karl May, der zu den meistgelesenen deutschsprachigen Autoren zählt, nicht der einzige Vertreter der deutschen Indianerfaszination ist, erfährt man im lesenswerten Wikipedia-Artikel über das Indianerbild im deutschen Sprachraum. Kafkas „Wunsch, Indianer zu werden“, spielt also vor diesem kulturgeschichtlichen Hintergrund. Das Besondere dieses Textes ist, dass er den weit verbreiteten Wunsch, der im Titel genannt wird, allmählich vollzieht. Wir können dabei an Freuds Betrachtung der Literatur in „Der Dichter und das Phantasieren“ denken, in der Freud die Literatur als Fortsetzung des Kinderspiels, als einen aufgeschriebenen Tagtraum begreift, in dem Wünsche ersatzweise erfüllt werden. ((1993, 31-40.))
In Kafkas Text wird der Wunsch durch die Sprache und die von ihr ausgelöste Fiktion vollzogen. Der Übergang vom Wunsch in die fiktive Wunscherfüllung kann recht genau bestimmt werden, denn der Text geht vom Modus des Wunschs, vom Konjunktiv II, ins Tempus einer Erzählung über, also ins Präteritum im Indikativ. Elegant ist der Übergang, weil Kafka die Ununterscheidbarkeit der Form des Konjunktivs II und des Indikativ Präteritum nutzt, so dass der Text vom Wunsch in die Fiktion hinübergleitet. Während zu Beginn bei „wäre“ noch der Konjunktiv II vorliegt, ist das darauffolgende Prädikat „erzitterte“ bereits ambivalent – es könnte sowohl im Konjunktiv II als auch Indikativ Präteritum stehen. Mit „ließ“ verschiebt sich der Modus in den Indikativ – der Konjunktiv II hieße „ließe“ – wie auch bei den folgenden Prädikaten („gab“, „wegwarf“, „gab“, „sah“). Mit dieser Verschiebung vom Wunsch ins Erzähltempus der Fiktion verschiebt sich auch die Blickrichtung, erzähltechnisch formuliert die Fokalisierung. Während beim Titel und dem Beginn des Nebensatzes das Bild des Indianers noch von außen evoziert wird und also eine externe Fokalisierung nahegelegt wird, wird die Fokalisierung bereits bei „erzitterte“ ambivalent. Es könnte zwar noch der Indianer von außen gesehen werden, jedoch regt das folgende „über zitterndem Boden“ bereits eine Perspektivierung durch den reitenden Indianer an, der auf den Boden schaut. Dieser wirkt deshalb so, als würde er zittern, weil die eigene Bewegung auf die Umgebung übertragen wird – durch den zitternden Blick eines zitternden Körpers. Die Wunscherfüllung geschieht also nicht nur auf der Ebene von Modus und Tempus, sondern auch durch eine Simulation der Körperwahrnehmung und die Verschiebung einer externen auf eine interne Fokalisierung.
Mit dem darauffolgenden Abwerfen des Zaumzeugs wird eine zunehmende Konkretisierung des Wunschbilds beschworen, als vollziehe sie sich im Laufe des Textes. In diesem Prozess wird das Bild korrigiert und das zivilisatorische Zaumzeug abgelegt („Zügel“ und „Sporen“). Dabei zeichnet sich eine zunehmende Symbiose von Indianer und Pferd ab. Während nämlich der Blick und damit die Fokalisierung explizit in die Indianersubjektive verschoben wird („und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah“), erreicht der Prozess von Wunsch und fiktiver Erfüllung seinen heimlichen Höhepunkt: „schon ohne Pferdehals und Pferdekopf“. Heimlich ist dieser Höhepunkt deshalb, weil die Schlusswendung auch eine Wendung des eigentlichen Wunschs enthält. Denkt man nämlich die Textlogik weiter, nach der sich der Wunsch allmählich vollzieht und in den Wunschkörper des symbiotisch reitenden Indianers hineinimaginiert, dann zeigt sich am Ende, dass der eigentliche Wunsch nicht darin besteht, ein Indianer zu werden, sondern darin, dass Reiter und Pferd verschmelzen. Der „Wunsch, Indianer zu werden“ realisiert damit einen weiterführenden Wunsch: Den Wunsch, Zentaure zu werden. Aus dieser Perspektive ergibt dann auch die sonst eigentümlich erscheinende Formel „ohne Pferdehals und Pferdekopf“ Sinn: Ein Zentaure hat einen Menschenhals und Menschenkopf.
Der Indianertext wäre also eigentlich ein Zentaurentext. Vier Aspekte erscheinen dabei exemplarisch für Kafkas Tiertexte: 1) Der Text vollzieht mit oder im Tier einen körperlichen Zustand. Die Tiere stehen dadurch in einer Reihe mit körperlichen (Extrem-)Zuständen, die Kafkas Texte immer wieder in Szene setzen, vgl. den berühmten Anfang von „Die Verwandlung“: „Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch […]“ ((Kafka, 1996, 96.)). Auch hier wird wie beim Indianer/Zentauren die Simulation des Körpergefühls über die Fokalisierung des Blicks gesteuert. Weitere prominente Beispiele für körperliche Extremzustände in Kafkas Erzählungen sind „Der Hungerkünstler“, der bis zur körperlichen Auflösung hungert, „In der Strafkolonie“, in dem der Verurteilte das Urteil „mit den Wunden entziffert“ oder „Der Kübelreiter“, der auf einem Kübel in wellenförmigen Ritt durch die Stadt schwebt. 2) Durch das Evozieren der körperlichen Extremzustände kommt dem Schreiben eine autosuggestive, wenn nicht autoerotische Funktion zu. ((Kremer, 1998.)) 3) Der Nachvollzug der Wahrnehmung, die Simulation, wird beim „Wunsch, Indianer zu werden“ durch das Verschieben der narrativen Fokalisierung erreicht. Während der Indianer anfangs noch von außen als externe Fokalisierung vorgestellt werden kann, verschiebt sich spätestens mit dem „sah“ die Fokalisierung nach innen. Die „Tiergeschichte“, die diese Fokalisierung durch ein Tier am Ende von Kafkas Leben am radikalsten verwirklicht, ist „der Bau“. Tiere sind daher nicht allein ein Thema, sondern im doppelten Wortsinn ein Sujet der Erzählungen. 4) Kafkas Tiere sind wie der Zentaure oftmals eher Mischwesen, die sich in der Grenzregion von Tier und Mensch einnisten und dort zu Hause sind.
III.
Ein theoretischer Ansatz für das poetologische Verfahren derartiger Verwandlungen durch das Erzählen stammt von Walter Benjamin. In seiner „Lehre des Ähnlichen“ ((1991, 204-210.)) entwickelt er den Begriff des „mimetischen Vermögens“, das die Fähigkeit zur Produktion von Ähnlichkeiten bezeichnet. Das „mimetische Vermögen“ lässt sich im Kontext von Kafkas Tiererzählungen produktionsästhetisch wenden, d.h. Kafka betreibt eine Mimesis ans Tier. Damit wäre auch betont, dass sich die Texte auf Tiere zubewegen, dass Tiere damit nicht einseitig wie in Fabeln anthropomorphisiert werden, sondern die Leser wie die Maus in Kafkas „Kleine Fabel“ „die Laufrichtung ändern“ ((Kafka, 1996, 382.)) und eine Animalisierung des Menschlichen anstreben. Diese chiastische Bewegung, diese Kreuzung von Sprach- und Denkwegen, ist die für Kafkas Tiere charakteristische. ((Vgl. Jochen Thermann: Kafkas Kreuzungen.)) Deshalb ist die Anschlussfähigkeit an die animal studies auch nur bedingt möglich. ((Es sei denn man betont wie Harriet Ritvo in seinen Überlegungen zum animal turn gerade die paradoxe Gleichzeitigkeit von anthropologischer Differenz und kategorischer Gleichheit von Mensch und Tier. (Ritvo, 2007, 119).))
Aber nicht nur der Mensch wird animalisiert, auch das, was ihn über das Tier erhebt, Sprache und Literatur, erhält Züge des Tierischen. In den Tagebüchern reflektiert Kafka über sein Schreiben und sein Schreibtempo: „Kann ich die Geschichten nicht durch die Nächte jagen, brechen sie aus und verlaufen sich“ ((Kafka, 1990, 715)) notiert Kafka am 4. Januar 1915 in sein Tagebuch. Und am 14. Dezember 1914 beklagt er sich über die Langsamkeit seines Schreibens: „Jämmerliches Vorwärtskriechen der Arbeit.“ ((Ebd., 709.)) Mal nimmt das Schreiben die Bewegungsform des Kriechens an, mal sind es die Geschichten, die Tierform annehmen und gejagt werden müssen.
Die Mimesis ans Tier geht weiter, sie wuchert, sie betrifft das Schreiben, die Texte, das literarische Werk. In den Tagebüchern erscheint die Literatur dann selbst wie eine Tiersprache. Einen Beleg für diesen zirkulären Befund liefert die Erzählung „Ein altes Blatt“. Eine Hauptstadt wird dort von einer Horde Nomaden überfallen und belagert. Das Szenario erinnert an „Beim Bau der chinesischen Mauer“; zum Erschrecken der Belagerten tragen unter anderem die Pferde der Nomaden bei, von denen berichtet wird: „selbst ihre Pferde fressen Fleisch.“ Auch die Nomaden selbst wirken äußerst tierisch in ihrem Auftreten, -- an einer Stelle der Erzählung sprangen sie einen Ochsen an, „um mit den Zähnen Stücke aus seinem warmen Fleisch zu reißen“. Folgerichtig erscheinen sie nicht sprachfähig: „Oft machen sie Grimassen; dann dreht sich das Weiß ihrer Augen und Schaum schwillt aus ihrem Munde, doch wollen sie damit weder etwas sagen noch auch erschrecken; sie tun es, weil es so ihre Art ist.“ (308) Schließlich heißt es: „Sprechen kann man mit den Nomaden nicht. Unsere Sprache kennen sie nicht, ja sie haben kaum eine eigene. Unter einander verständigen sie sich ähnlich wie Dohlen. Immer wieder hört man diesen Schrei der Dohlen.“ (307)
Die Dohlen kommen an dieser Stelle durchaus überraschend und wirken ungewöhnlich. Eine weitreichende Interpretation ergibt sich, wenn man „Dohlen“ ins Tschechische übersetzt: Die Dohle heißt auf Tschechisch „kavka“. Demnach sind die Schreie der Nomaden Kafkas Schreie. Wenn wir die Schreie der Dohlen als Kafkas Schreie und diese als eine Metonymie seiner Literatur interpretieren, dann wäre Kafkas Literatur also eine Verständigungsform von halb menschlichen, halb tierischen Wesen.
Eine Möglichkeit diesen „Schrei der Dohlen“ zu interpretieren, wäre sie im Rückgriff auf psychoanalytisches Vokabular als eine Rückkehr des Verdrängten zu verstehen. In seiner „Ästhetischen Theorie“ denkt Theodor W. Adorno in diesem Sinne über Tiere und die Tiernatur des Menschen nach. Für ihn bilden sie eine der „Grundschichten der Kunst“ ((1986, 181-182.)):
Nicht so durchaus ist der Gattung Mensch die Verdrängung ihrer Tierähnlichkeit gelungen, daß sie diese nicht jäh wiedererkennen könnte und dabei von Glück überflutet wird; die Sprache der kleinen Kinder und der Tiere scheint eine. In der Tierähnlichkeit der Clowns zündet die Menschenähnlichkeit der Affen; die Konstellation Tier/Narr/Clown ist eine von den Grundschichten der Kunst.
Auf dieser Schwelle bewegte sich bereits der Zentaure und auch der Affe Rotpeter ist ein solches Mischwesen. Weil Kafkas Tiere einerseits das weg-, sprach- und erinnerungslose Dasein reflektieren und sie andererseits genau diesen Zustand auf je spezifische Weise ironisieren, kann man sie als Mischwesen, als Kreuzungen begreifen, etwas im Sinne der Konstellation Affe/Narr/Clown oder Nomade/Dohle/Kafka oder Pferd/Indianer/Zentaure.
Die Herkunft der Nomaden in „Ein altes Blatt“ lässt sich zudem noch topographisch genauer bestimmen: Es ist ein Raum der Wildnis, die weglose Steppe, in die sie wieder eingehen und wo sie sich, wie in der verwandten Erzählung „Beim Bau der chinesischen Mauer“ festgestellt wird, „in die leere Luft […] verrennen werden.“
Ein solch unmarkierter Raum ist ein Fluchtraum jenseits der Kultur, außerhalb der Grenzen des Selbstbewusstseins, ohne Spuren und Codierungen, den nicht nur die Nomaden evozieren, die sich in der „Luft zu verrennen“ drohen, sondern mit unterschiedlichen Schattierungen auch der Indianer/Zentaure in der „glatt gemähte[n] Heide“, der Affe Rotpeter, wenn er an die „Freiheit nach allen Seiten“ ((Kafka, 1996, 326.)) im Urwald seiner Kindheit denkt, „Der Kübelreiter“, der sich in den „Regionen der Eisgebirge“ ((Kafka, 1996, 279.)) verliert oder das Tier aus „Der Bau“, das auf einer ekstatischen Jagd durchs Unterholz prescht und sich selbst fremd wird. Solche Räume stellen ein wiederkehrendes Jenseits in Kafkas Prosa dar. Die Tiere kennen die Wege dorthin oder sie können zumindest den Weg weisen.

IV.
Was im Indianertext angedeutet wird, wird in „Der Bau“ zum Bauprinzip des Textes: die interne Fokalisierung: „Ich habe den Bau eingerichtet und er scheint wohlgelungen.“ (465) Die Baumetapher hat übrigens immer schon zur Interpretation des Baus als literarisches Werk eingeladen. Wenn „der Bau“, wie etwa Kafkas Biograph Rainer Stach anführt, als Kafkas Werk interpretiert wird, dann stellt sich natürlich die Frage, was in dieser Interpretation „das Zischen“ ist. Stach liefert hier eine durchaus überzeugende autobiographische Interpretation: Das Zischen ist Kafkas Lunge. Was Stach dabei nicht ausführt, ist, dass demnach „der Bau“ nicht nur das Werk Kafkas darstellt, sondern gleichzeitig auch dessen Körper – ich würde dem durchaus zustimmen, es bräuchte aber eben die Präzisierung, dass „der Bau“ mehrere Bedeutungsschichten hat: 1. als Werk des Tiers auf der Ebene der Narration, 2. als Werk des Autors auf der Ebene der Interpretation und 3. als Körper des Autors bei der Interpretation des Zischens als Kafkas kranke Lunge. Im Folgenden werde ich ausführen, dass der Bau 4. auch als Körper des Tiers gelesen werden kann. Dieser vierfache Sinn des Baus macht den Text entsprechend vielschichtig und erzeugt durch die Dopplung von Körper und Werk ein kafkaeskes Oszillieren des Sinns.
Die interne Fokalisierung geht so weit, dass wir die Welt komplett aus der Tierperspektive sehen, und diese Welt besteht fast ausschließlich aus dem Bau. Diese Subjektivierung des tierischen Blicks vollzieht auf literarische Weise, was der Biologe Jakob von Uexküll auf biologische Weise vollzog. Von Uexkülls Ansatz, den er um 1900 entwickelte, begreift die Umwelt der Tiere als Produkte ihrer Wahrnehmungsorgane ((Uexküll von, 1909.)) D.h. in der Nachfolge von Kant, der die Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung für die Konstruktion der Welt herausgearbeitet hat, überträgt von Uexküll dieses a priori der Sinne auf die Welt der Tiere. Dabei rekonstruiert er aus den Perzeptionsfähigkeiten der tierischen Sinnesorgane deren Wahrnehmung von Welt. Die Umwelt des Tiers ist dementsprechend durch deren Innenwelt geprägt; die Welt eines Hundes ist durch seine Nase radikal anders.
Während „der Bau“ einerseits als die selbst geschaffene Umwelt des Tiers erscheint, wirken Bau und Tier miteinander verschmolzen, so heißt es auch, dass das Blut im eigenen Boden versickern würde. Ganz analog spricht auch Uexküll von „Reizen als Mauern“, die das Tiersubjekt wie ein selbstgeschaffenes Haus umgeben: „Die Reize der Umwelt bilden zugleich eine feste Scheidewand, die das Tier wie die Mauern eines selbstgebauten Hauses umschließen und die ganze fremde Welt von ihm abhalten.“ Das selbstgebaute Haus wird hier als Metapher für den Wahrnehmungsapparat genutzt. In diesem Sinne scheinen im „Bau“ Innen und Außen zu kollabieren; dementsprechend ist das Befinden des Tiers vom Aufenthaltsort im „Bau“ abhängig; der Bau ist also gleichermaßen Umwelt und Innenwelt des Tiers; er ist das Produkt seiner Handlungen, aber auch der Produzent seiner Gefühle und Gedanken. Diese Kopfgeburt des Baus wird auch an dem Werkzeug deutlich, mit dem er es geschaffen hat: „mit der Stirn“. Der Stirn kommt auch in Kafkas eigenem Schreiben eine sinnbildliche Bedeutung zu, wenn er über das Gelingen und Nicht-Gelingen in den Tagebüchern notiert: „Sein eigener Stirnknochen verlegt ihm den Weg (an seiner eigenen Stirn schlägt er sich die Stirn blutig).“ ((Kafka, 1990, 851.))
Wenn man den „Bau“ in seinem konstruktivistischen Kollaps von Innen und Außen begreift, erscheint das Verlassen des Baus als ekstatischer Zustand – er ist allerdings nur von kurzer Dauer, zu groß ist die Sorge um den Bau. Dementsprechend verdoppelt sich das Tier bei seiner Rückkehr in seinen eigenen Doppelgänger: „Mir ist dann, als stehe ich nicht vor meinem Haus, sondern vor mir selbst.“ ((Kafka, 1996, 476.)) Es betrachtet sich als seinen eigenen Feind: „es ist schon fast so, als sei ich der Feind und spionierte die passende Gelegenheit aus, um mit Erfolg einzubrechen.“ ((Ebd., 480.))
Wir können den Bau als eine Allegorisierung des literarischen Werks und das Graben demnach als Allegorisierung des Schreibens interpretieren; das deckt sich mit der eben bemerkten Relevanz der Stirn – sie ist Werkzeug des Tiers und erscheint mehrfach in den Tagebüchern als wesentlich für den Schreibprozess. Dieser Befund entspricht auch dem Schrei der Dohlen; in beiden Texten wären demnach die literarischen Erzeugnisse die Erzeugnisse eines Tiers. Tiere sind also nicht nur Sujet/Thema der Erzählungen, sie werden auch als Sujet/Subjekt des Schreibens dargestellt.
V.
In einem kurzen Aphorismus von Kafka heißt es: „Das Tier entwindet dem Herrn die Peitsche und peitscht sich selbst, um Herr zu werden und weiß nicht, daß das nur eine Phantasie ist, erzeugt durch einen neuen Knoten im Peitschenriemen des Herrn.“ ((Kafka, 1992, 119.)) Interpretieren wir die Peitsche als Schreibwerkzeug, dann erzeugt der Autor/Herr gekonnt die Illusion, das Tier würde sich selbst ermächtigen und Autor/Herr werden, hier also Erzähler; die Tiere sind demnach deshalb so präsent in Kafkas Texten, weil es einen Hang gibt, sie zur Sprache kommen zu lassen. Diese Fiktionalisierungen, ein Knoten im „Peitschenriemen“ des Autors, erzeugen paradoxe Wendungen auf der anthropologisch aufgeladenen Schwelle von Tier und Mensch. Gerhard Neumann spricht im Zusammenhang der Invertierungen des Sinns vom gleitenden Paradox in der Prosa Kafkas. ((1968, 704-744.)) Es zeigt auch in den „Tiergeschichten“, wie Kafka die Erzählungen selbst in einem Brief bezeichnete, seine Wirkung.
Es gehört zu den Eigenarten von Kafkas Tieren, dass sich an ihnen ein Phänomen zeigt, dass für Kafkas Prosa insgesamt charakteristisch ist. Zunächst erscheinen sie extrem körperlich. Die Körperlichkeit dieser Sprachtiere beruht auf einer Simulation von Wahrnehmungen. Diese Simulationen übersteigen in der Fiktion menschliche Erfahrungshorizonte: ein Affe lernt sprechen, ein Tier reflektiert über seinen Bau. Durch diese sprachlich evozierte Körperlichkeit gewinnen Kafkas Tiere eine fiktive Wirklichkeit. Sie erzeugen im Leser deshalb einen Resonanzraum, weil sie auf die im Subjekt selbst existierenden anthropologischen Schwellen zwischen Tier und Mensch hinweisen, die nicht allein die Kultur durchziehen, sondern jedes menschliche Subjekt. Mit anderen Worten: Der Leser oder etwas im Leser fühlt sich angesprochen. So kommt dem Leser die Unruhe des Bautiers bekannt vor, man erkennt sich wieder, ehe man sich besinnt, dass hier ein Tier gerade seine Regenwürmer sortiert und verfrachtet. Daher die Komik, wenn das Bautier einschläft und mit einer Ratte im Maul erwacht, weil gleichzeitig der Leser erwacht und sich erinnert, dass das Wesen, in dem er sich wiedererkannt hat, eine Ratte im Maul trug.
Fußnoten
Bibliografie
ADORNO, Theodor W. 1986. « Ästhetische Theorie », in Theodor W. Adorno, Gesammelte Schriften, hg. v. Rolf Tiedemann unter Mitwirkung von Gretel Adorno, Susan Buck-Morss und Klaus Schultz, Band 7. Frankfurt am Main : Suhrkamp. S.181-182.
AGAMBEN, Giorgio. 2003. Das Offene. Der Mensch und das Tier, aus dem Italienischen übersetzt von Davide Giuriato. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag.
BENJAMIN, Walter. 1991. « Lehre vom Ähnlichen », in Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser (Hrsg.), Gesammelte Schriften, unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem, Band II/1. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, S. 204-210.
DERRIDA, Jacques. 2006. L'Animal que donc je suis. Paris : Galilée.
FREUD, Sigmund. 1993. « Der Dichter und das Phantasieren », in Sigmund Freud, Der Moses des Michelangelo. Schriften über Kunst und Künstler, Einleitung von Peter Gay. Frankfurt am Main : Fischer Verlag, S. 31-40.
KAFKA, Franz. 1996. Die Erzählungen und andere ausgewählte Prosa, herausgegeben von Roger Hermes. Frankfurt am Main : Fischer Verlag.
KAFKA, Franz. 1992. Nachgelassene Schriften und Fragmente II, Jost Schillemeit (Hrsg.). Frankfurt am Main : Fischer Verlag.
KAFKA, Franz. 1990. Tagebücher, Hans-Gerd Koch, Michael Müller und Malcolm Pasley (Hrsg.). Frankfurt am Main : Fischer Verlag.
KREMER, Detlef. 1998. Kafka. Die Erotik des Schreibens. Bodenheim bei Mainz : Philo Verlagsges.
NEUMANN, Gerhard. 1968. « Umkehrung und Abwandlung. Franz Kafkas „gleitendes Paradoxon“ », in DVJS, Bd. 42, Sonderheft, S. 704-744.
RITVO, Harriet. 2007. « On the Animal Turn », Daedalus, volume 136, n°4, p.118-122.
THERMANN, Jochen. 2010. Kafkas Tiere. Fährten, Bahnen und Wege der Sprache. Marburg : Tectum Wissenschaftsverlag.
UEXKÜLL von, Jakob. 1909. Die Umwelt und Innenwelt der Tiere. Berlin : Springer.
Pour citer cette ressource :
Jochen Thermann, Die Schreie der Dohle. Einige Anmerkungen zu den Tieren in Kafkas Erzählungen, La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), septembre 2023. Consulté le 21/02/2026. URL: https://cle.ens-lyon.fr/allemand/litterature/mouvements-et-genres-litteraires/tournant-du-xxe/die-schreie-der-dohle-einige-anmerkungen-zu-den-tieren-in-kafkas-erzahlungen



 Activer le mode zen
Activer le mode zen